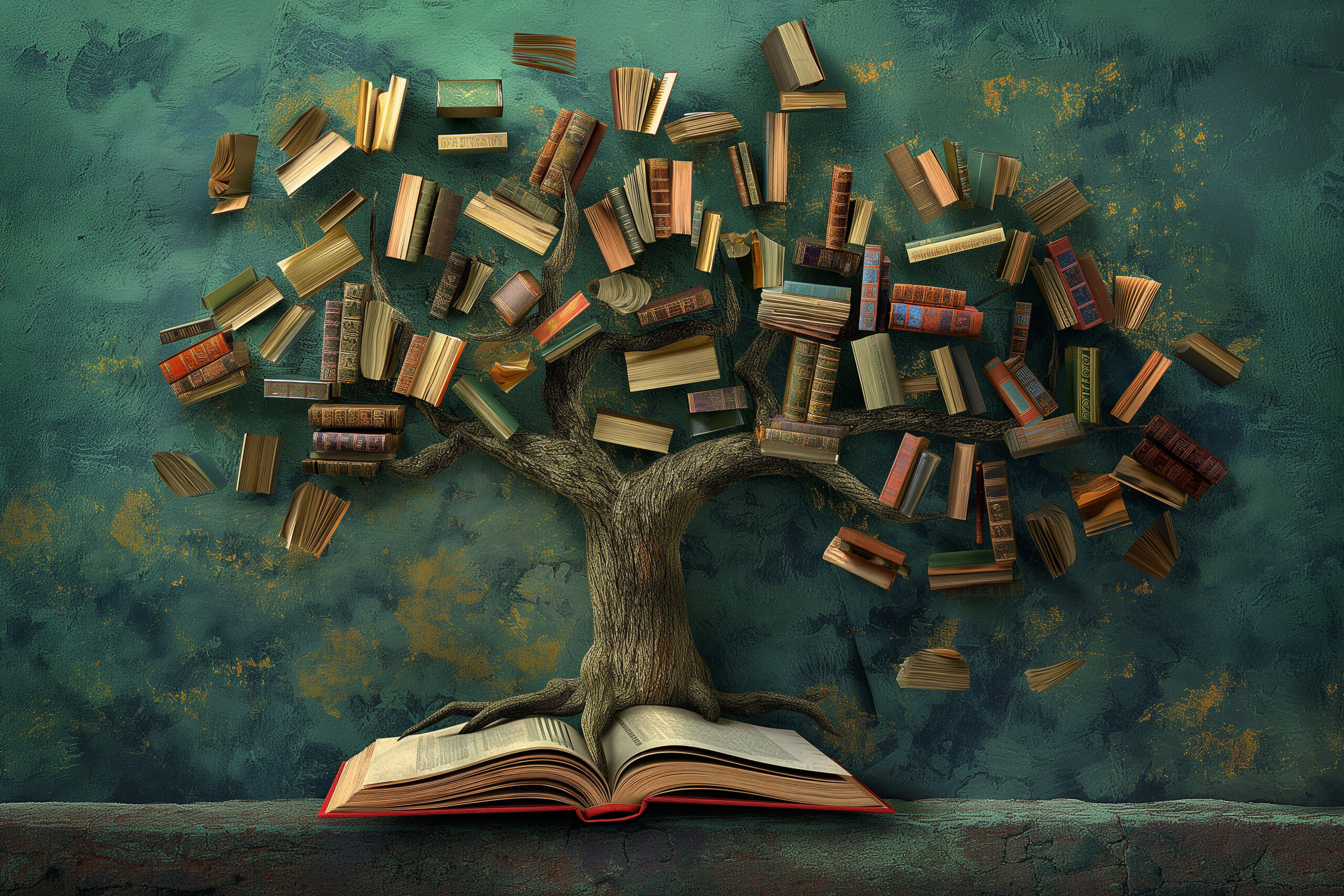Die AGB-Kontrolle bremst Ihre*n Dienstgeber*in
Der*Die Dienstgebende legt dem*der Bewerbenden in der Regel einen Vertragstext vor, nach dem altbekannten Motto „Friss oder stirb“. Da ist es gut, dass mittlerweile schon seit vielen Jahren die besonderen gesetzlichen Kontrollbestimmungen bei Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB-Kontrolle) praktisch alle Arbeitsverträge erfassen. Diese bremsen Dienstgebende und verhindern eine allzu einseitige Festlegung von Arbeitsbedingungen zulasten der Bewerbenden.
Die AGB-Kontrolle ist in den §§ 305 ff. Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) geregelt. Ihre Funktionsweise hatte ich grundsätzlich bereits in der Sonderausgabe zu den Arbeitsbedingungen und ihrer Änderung beschrieben.
An dieser Stelle möchte ich die AGB-Kontrolle nun im Rahmen und aus dem Blickwinkel der Einstellung nochmals zur Auffrischung darstellen.
Filter, Schirm, Schild – wichtig ist der Schutz vor unfairen Regelungen
Grundgedanke der AGB-Regelungen ist, dass ein* Vertragspartner*in, der*die dem*der anderen Vertragspartner*in vertragliche Bestimmungen praktisch vorschreibt, dabei zumindest gewisse Grenzen einhalten muss und nicht unfair zu seinem*ihrem eigenen Vorteil agieren darf.
Theoretisch kann natürlich niemandem eine vertragliche Regelung aufgezwungen werden. So können auch Bewerbende einen ihnen angebotenen Vertrag ablehnen, wenn er ihnen unfair erscheint.
Die Konsequenz wird dann in der Praxis aber regelmäßig nicht sein, dass sie einen anderen, „fairen“ Vertrag erhalten, sondern dass sie schlicht die Stelle nicht bekommen. Dem trägt der Gesetzgeber Rechnung, indem er solche vom*von der Dienstgebenden einseitig vorgeschriebene Regelungen zwar grundsätzlich zulässt, aber je nach Inhalt für unwirksam erklärt.
In der Sonderausgabe zur Änderung von Arbeitsbedingungen hatte ich die AGB-Regelungen daher mit Filtern verglichen, in denen unfaire Klauseln hängen bleiben. Sie können sich die AGB-Kontrolle aber auch als Schutzschirm oder Schutzschild vorstellen, an dem unfaire Regelungen abprallen.
Die Eintrittsschwelle in die AGB-Kontrolle ist ziemlich niedrig
Wie in der genannten Sonderausgabe gesehen, stellt die Rechtsprechung keine hohen Anforderungen an den Begriff der AGB und damit an das Eingreifen der AGB-Kontrolle.
Im kirchlichen Bereich ist dabei vor allem wichtig, dass die AVR Caritas kein Tarifwerk im Sinne des § 310 Abs. 4 BGB sind und damit nicht von der AGB-Kontrolle ausgenommen sind. Dasselbe gilt für den BAT-KF, weil dieser zwar „Tarifvertrag“ heißt, aber in Wahrheit rechtlich gesehen gar kein „echter“ Tarifvertrag ist.
Der Gesetzgeber erhöht bewusst das Risiko für Arbeitgebende
Wenn AGB im Sinne des Gesetzes vorliegen und eine Klausel sich nach Prüfung als unwirksam herausstellt, betrifft das zwar nur diese Klausel und nicht den gesamten Vertrag. Zumindest diese betroffene Klausel ist dann aber komplett unwirksam und wird nicht auf das gerade noch zulässige Maß zurechtgestutzt. Dies ist ein ganz wichtiger Grundsatz des AGB-Rechts. Juristisch spricht man davon, dass keine „geltungserhaltende Reduktion“ der betroffenen Klausel stattfindet.
Der Gesetzgeber erhöht damit bewusst das Risiko für Arbeitgebende. Diese sollen nämlich davon abgehalten werden, überzogene Klauseln in die Verträge hineinzuschreiben und sich dabei auf die beruhigende Aussicht zu verlassen, dass schlimmstenfalls das gerade noch zulässige Maß einer Frist oder einer Vertragsstrafe vom Gericht durchgewinkt wird. Vielmehr gehen Arbeitgebende das Risiko ein, ganz mit leeren Händen dazustehen, wenn sie zu hoch pokern.
Man kann es vielleicht ein bisschen mit den Bußgeldern im Straßenverkehr vergleichen: Bei Verstößen gibt es unter anderem Bußgelder als Konsequenz. Ziel der Maßnahmen im Verkehr ist aber eigentlich nicht die Einnahme von Bußgeldern. Vielmehr soll die angedrohte Strafe abschrecken und im Idealfall dafür sorgen, dass sich alle an die Regeln halten und gar keine Sanktionen notwendig sind.
AGB-Regeln: Fairness und Transparenz sind Trumpf
Der Gesetzgeber hat verschiedene Prüfungsmechanismen bei der AGB-Kontrolle eingebaut. Die wichtigsten dieser Prüfpunkte kann man etwas vereinfacht so beschreiben:
- Klauseln dürfen keine unangemessene Benachteiligung enthalten (§ 307 Abs. 1 Satz 1 BGB).
- Klauseln dürfen nicht intransparent sein (§ 307 Abs. 1 Satz 2 BGB).
- Klauseln dürfen die „wesentlichen Grundgedanken“ einer gesetzlichen Regelung nicht verletzen (§ 307 Abs. 2 Nr. 1 BGB).
- Klauseln dürfen nicht im Text „versteckt“ werden und so den*die Vertragspartner*in überraschen (§ 305c Abs. 1 BGB).
Die Rechtsprechung hat auf Basis dieser und noch einiger anderer „Filter“ zu zahlreichen arbeitsvertraglichen Standard-Klauseln Grundsätze für die Grenzen der Wirksamkeit entwickelt, vor allem zu folgenden Klauseln:
- Abtretungsverbote
- Ausschlussklauseln, auch Verfallklauseln genannt
- Rückzahlungsklauseln bezüglich Fortbildungskosten
- Überstundenabgeltungsklauseln
- Versetzungsklauseln
- Vertragsstrafenklauseln
- Widerrufsvorbehalte
Die Rechtsprechung zieht hier z. T. recht enge Grenzen. Daher können Bewerbende im Zweifel solche Klauseln beruhigt unterschreiben, anstatt zu riskieren, dass sie nicht eingestellt werden.
Unwirksamkeit der Klausel ist nicht immer das „letzte Wort“
Grundsätzlich gilt, dass eine Klausel unwirksam ist, wenn sie gegen die AGB-Kontrolle verstößt. Wie zuvor erläutert, ist die Klausel dann komplett „weg“ und bleibt nicht etwa in einer entschärften Version doch noch bestehen.
Allerdings muss man bei den Konsequenzen, die die Unwirksamkeit der Klausel hat, genau hinsehen. Das gilt vor allem bei der Überstundenabgeltungsklausel. Eine nicht untypische Klausel sieht etwa so aus:
Eine solche Klausel ist unwirksam. Sie verstößt gegen das Transparenzgebot. Ein*e Bewerber*in kann in so einem Fall nämlich nicht erkennen, wie viele Stunden er*sie letzten Endes für die vereinbarte Vergütung arbeiten muss. Der*Die Dienstgebende könnte mit anderen Worten das vertragliche Gleichgewicht zwischen Leistung und Gegenleistung völlig unterlaufen.
Das Problem ist aber, dass mit dem Wegfall der Klausel noch nichts gewonnen ist. Es fehlt dann nämlich noch immer an einer Rechtsgrundlage für die Überstundenvergütung. Um dieses Problem zu lösen, greift die Rechtsprechung auf § 612 BGB zurück. Danach ist eine Vergütung zu zahlen, wenn sie „nach den Umständen zu erwarten“ ist. Es kommt also auf die (angemessene) Erwartungshaltung an.
Diese ist nach der Rechtsprechung regelmäßig gegeben, wenn man als Mitarbeiter*in unterhalb der Beitragsbemessungsgrenze für die Rentenversicherung verdient. Diese ändert sich jährlich. Im Jahr 2025 liegt sie bei 8.050 € brutto pro Monat. Die meisten kirchlichen Mitarbeitenden sind daher nicht betroffen und erhalten somit im Falle einer unwirksamen Überstundenabgeltungsklausel Überstunden bezahlt.
Ähnlich ist es bei Versetzungsklauseln. Diese sind nach der Rechtsprechung unwirksam, wenn sie nicht ausdrücklich vorsehen, dass eine neu zugewiesene Tätigkeit mindestens gleichwertig sein muss. Die Unwirksamkeit der Klausel bedeutet aber nicht, dass jegliche Zuweisung einer anderen Tätigkeit rechtswidrig wäre. Wenn beispielsweise die neue Tätigkeit von der Beschreibung der Grundtätigkeit erfasst ist, bleibt eine Zuweisung möglich.
Auch Weihnachtsgeld & Co. müssen fair sein
Durch die Aussicht auf eine Sonderzahlung wie z. B. einen Bonus oder ein Weihnachtsgeld möchten Arbeitgebende Mitarbeitende besonders motivieren.
Einige Arbeitgebende möchten ihre Verträge aber so gestalten, dass sie sich dabei nicht binden, sondern nach Belieben von einer Zahlung wieder Abstand nehmen können. Trotzdem soll die Formulierung so konkret sein, dass sie einen Leistungsanreiz für den*die betroffene*n Mitarbeiter*in bildet. Bei diesem „Spagatversuch“ kommt den Arbeitgebenden aber regelmäßig das AGB-Recht in die Quere.