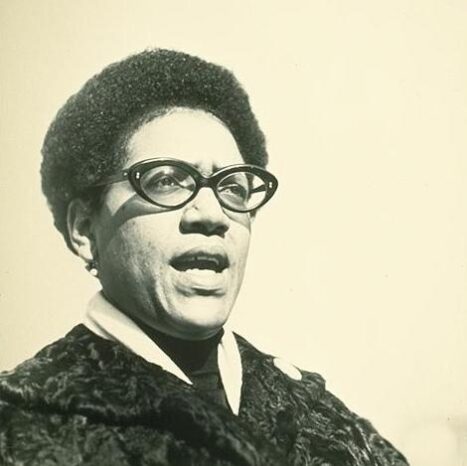Lebenslauf
| Datum/Jahr | Ereignis |
|---|---|
| 25.12.1890 | Geboren in Bernburg an der Saale |
| 1915–1918 | Studium an der Hochschule für Frauen in Leipzig |
| 1918–1920 | Studium der Sozialwissenschaften an der Universität München |
| 1920–1922 | Studium der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften an der Universität Frankfurt a. M. |
| 1922 | Erhalt des Diploms für Sozial- und Verwaltungsbeamt*innen |
| 1924 | Promotion in Sozialwissenschaften an der Universität Frankfurt a. M. |
| Ab 1925 | Dozentin für Wohlfahrtspflege im Verein „Jugendheim Charlottenburg“ |
| 1925–1927 | Assistentin der Reichstagspolitikerin Getrud Bäumer |
| 1927–1931 | Geschäftsführerin des „Bundes Deutscher Frauenvereine“ |
| 1927, 1929–1930 | Dozentin für Sozialpädagogik an der „Deutschen Akademie für soziale und pädagogische Frauenarbeit“ |
| 1935 | Flucht nach England |
| 1935–1957 | Leiterin und Lehrerin an der „Stoatley Rough School“ |
| 9.11.1969 | Gestorben in Haslemere, England |
Mehr Rechte und mehr Bildung für Mädchen und Frauen, das waren die großen Anliegen von Emmy Wolff. Als Dozentin und Publizistin setzte sie sich für diese ein, bis das Naziregime ihrem Engagement ein abruptes Ende setzte.
Aufgewachsen in bürgerlichen Verhältnissen
Emmy Wolff wurde am 25. Dezember 1890 im beschaulichen Bernburg an der Saale – in der Nähe von Halle und Magdeburg – geboren. Sie war die älteste Tochter von Paul und Julie Wolff; Paul Wolff arbeitete als Bankier, Julie Wolff arbeitete ehrenamtlich in der jüdischen Gemeinde von Bernburg.
Die Familie war dem gehobenen Bürgertum zuzuordnen und jüdischen Glaubens. Emmy Wolff wuchs mit zwei jüngeren Geschwistern auf und besuchte, wie es im gehobenen Bürgertum üblich war, bis zum 14. Lebensjahr eine Höhere Tochterschule und anschließend das Mädchenpensionat „Ecole supérieure“ in der Schweiz.
Studium an der „Hochschule für Frauen“
Ihre gute Schulbildung befähigte Emmy Wolff zum Studium. Ihr konservativer Vater unterstützte ihren Wunsch zu studieren allerdings nicht. Doch die junge Frau setzte sich durch und besuchte von 1915 bis 1918 die „Hochschule für Frauen“, die 1911 in Leipzig gegründet worden war. Dort studierte sie Sozial- und Rechtswissenschaften mit dem Ziel, Wohlfahrtspflegerin zu werden.
Während ihres Studiums in Leipzig gründete sie eine öffentliche Bibliothek und leitete diese. Zudem arbeitete sie als Prokuristin in der Bank ihres Vaters.
Engagement in Frauenvereinen
Nach ihrem Abschluss an der „Hochschule für Frauen“ ging Emmy Wolff nach München und studierte an der dortigen Universität Sozialwissenschaften. Während ihrer Studienzeit engagierte sie sich in den Jugendorganisationen des „Stadtbundes Münchener Frauenvereine“.
Sie war zudem als Geschäftsführerin des „Hauptverbandes Bayerischer Frauenvereine“ und als Schriftleiterin des „Verbandsorgans Bayerischer Frauenzeitung“ tätig. In dieser beschrieb sie 1920 kritisch die Situation der bürgerlichen Frauenbewegung:
„Die Frauenbewegung war aus der Mode gekommen; vergeblich sahen ihre Führerinnen sich nach dem neuen Nachwuchs um. Undankbar war er damit beschäftigt, ihre Ernte zu verspeisen und sie dabei als kompromittierenden Zusammenschluss von Überweibern zu schmähen, wenn er überhaupt von ihrem Vorhandensein […] etwas wusste.“
Mitglied im „Neuen Kreis für Frauenfragen“
Noch im selben Jahr ging sie nach Frankfurt am Main und studierte an der dortigen Universität Wirtschafts- und Sozialwissenschaften sowie Sozialpolitik. Sie schloss sich zudem dem „Neuen Kreis für Frauenfragen“ an, einem reichsweiten Zusammenschluss junger Frauen.
„[Sie] versuchten, ihren Platz innerhalb der gewachsenen, auch unflexiblen Strukturen der bürgerlichen Frauenbewegung zu finden“, beschrieb Emmy Wolff die Gruppe. „Diese dritte Generation diskutierte über ihr Selbstverständnis als neue Frauen, über aktuelle und zukünftige Aufgaben der Bewegung.“
Promotion über den „Mädchenclub“
1922 erhielt sie ihr Diplom für Sozial- und Verwaltungsbeamte, 1924 promovierte sie an der Universität in Frankfurt am Main und erhielt den Titel „Dr. rer. pol.“. Ihre Dissertation trug den Titel „Ein Mädchenclub und der Herkunftskreis seiner Mitglieder. Ein Beitrag zum Problem der Erfassung schulentlassener weiblicher Jugend durch die Jugendpflege“.
In ihrer Doktorarbeit untersuchte sie einen Mädchenclub, der von der jüdischen Frauenbewegung zur Unterstützung alleinstehender junger Arbeiterinnen eingerichtet worden war und in dem sie selbst gearbeitet hatte.
Assistentin einer Reichstagspolitikerin und Dozentin
Nach ihrer Promotion ging Emmy Wolff nach Berlin und arbeitete dort ab 1925 als Assistentin der Reichstagspolitikerin Gertrud Bäumer. Diese berief sie auch in das Redaktionsteam der Zeitschrift „Die Hilfe“, ein Magazin für Politik, Wirtschaft und geistige Bewegung, das von Getrud Bäumer, Theodor Heuss und Walter Goetz herausgegeben wurde.
Ab 1925 war sie zudem als Dozentin für Wohlfahrtspflege und Kinder- und Jugendliteratur tätig. Im Sozialpädagogischen Seminar des Vereins „Jugendheim Charlottenburg“ bildete sie Jugendleiterinnen aus. Eine ihrer Kolleginnen im „Jugendheim“ war Hilde Lion; die beiden Frauen wurden alsbald ein Paar.
Emmy Wolff unterrichtete zusätzlich an der „Sozialen Frauenschule Berlin“ und an der „Werner-Schule“ des Deutschen Roten Kreuzes. Im Jahr 1927 sowie in den Jahren 1929 und 1930 war sie Dozentin für Sozialpädagogik an der „Deutschen Akademie für soziale und pädagogische Frauenarbeit.“
Veröffentlichung verschiedener Texte
Von 1927 bis 1931 übernahm Emmy Wolff die Geschäftsführung des „Bundes Deutscher Frauenvereine“ (BDF). Von 1928 bis 1931 gab sie das „Nachrichtenblatt des Bundes Deutscher Frauenvereine“ mit heraus. Von 1927 bis 1931 publizierte sie im Auftrag des BDF das Jahrbuch des Verbandes. Sie arbeitete zudem im Ausschuss des BDF für internationale Beziehungen mit und war Vertreterin war Presseausschuss des „Internationalen Frauenbundes“.
In der Zeitschrift der Frauenbewegung „Die Frau“ veröffentlichte Emmy Wolff ihre Gedichte sowie Berichte von Tagungen, Porträts von Schriftsteller*innen und Beiträge über den Schutz von Müttern und Arbeiterinnen, über die Jugendbewegung und das Thema Familie.
Flucht vor den Nationalsozialisten
Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten im Jahr 1933 musste Emmy Wolff all ihre Ämter und Lehrtätigkeiten niederlegen. Ihre Lebensgefährtin Hilde Lion, die ebenfalls jüdischer Abstammung war, flüchtete unmittelbar nach England und gründete in Haslemere für deutsche Flüchtlingskinder die Internatsschule „Stoatley Rough School“. Später wurden dort auch englische Schüler*innen aus schwachen sozialen Verhältnissen unterrichtet.
Emmy Wolff folgte ihrer Partnerin 1935 und übernahm an deren Seite die Leitung der Schule. Sie unterrichtete zudem die Fächer Deutsch, Französisch und Literatur und arbeitete als Köchin in der Internatsküche mit.
Emmy Wolff und ihre Lebensgefährtin reisten bis Ende 1938 mehrmals nach Deutschland zurück, um die Flucht von Kindern zu organisieren und sie zu begleiten. 1938 zum Beispiel begleitete Emmy Wolff 16 Kinder nach England – allen Gefahren und Warnungen zum Trotz.
Keine Rückkehr nach Deutschland
Nach einigen Jahren trennten sich Emmy Wolff und Hilde Lion, sie blieben durch ihre gemeinsame Arbeit an der Schule aber eng verbunden. Bis 1957 unterrichtete Emmy Wolff an der „Stoatley Rough School“, dann ging sie in den Ruhestand. Ihre alte Heimat Deutschland besuchte sie nur noch sporadisch. Am 9. November 1969 starb sie in Haslemere.
„Emmy Wolff repräsentiert die jüngere Generation der ersten deutschen Frauenbewegung, aus der sie entscheidende Impulse für ihr soziales, pädagogisches und politisches Engagement bezog und in der sie eine zentrale Position innehatte“, beschreibt die Sozialpädagogin Dr. Sabine Toppe die Bedeutung von Emmy Wolff. „Sie wirkte vielfältig in den Institutionen der Frauenbewegung und insbesondere in der Aus- und Weiterbildung von Frauen für die Soziale Arbeit.“